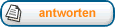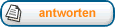gerhard hat geschrieben:
an alter mann:
Da kapiere ich etwas nicht! Ich habe alle 25 Fragen sehr gewissenhaft beantwortet: 8 mal ja, 17 mal nein. Un nu?
Ich habe sehr gerne gearbeitet, selten unter 50 h p.w. (bin schon längst im Ruhestand), meine Frau hatte keine Probleme mit meinem stressigen Job. Ich hatte einen Top-Job (echt TOP!) mit Dienstwagen und Top-Einkommnen. Dennoch: Nach der 25-Punkte-Liste dürfte das so nicht stimmen.
Mit Gruß
Gerhard
@Gerhard
Deine erreichten "8 mal ja" empfinde auch ich als einen durchaus guten Wert.
Menschen mit ähnlichen Werten haben sicher klare Vorstellungen was sie erreichen möchten, und verkaufen sich auch nicht so schnell unter Wert.
Deshalb kommen zur Zeit gerade diese Menschen schnell in Konflikte mit dem Arbeitsamt, Zeitarbeitsfirmen, oder privaten Arbeitsvermittlern.
Gerhard, die Zeiten haben sich geändert, die Wahrscheinlichkeit zu den 30% dieser "Sozialschmarotzer"(so nennt sie Lars) zugeordnet zu werden, wäre auch für dich heute sehr hoch.
Im Moment werden vorrangig Menschen zu "Helden der Arbeit" erkoren, welche oftmals überhaupt nicht mehr in der Lage sind zu erkennen, warum sie was tun, und eigentlich dringendst Hilfe benötigen, statt von der Gesellschaft als billige Arbeitskräfte ausgenutzt zu werden.
Den Fragebogen hatte ich etwas"zweckentfremdet", er wurde zum Erkennen von Arbeitssucht entwickelt.
Hier ist die Orginale Auswertung:
http://www.gesundheitstipps.wicker-klin ... ssucht.pdf
Zitat:
"Dr. Mentzel arbeitete einen Alkoholiker-Fragebogen um, indem er Alkohol und Trinken durch Arbeiten ersetzte. Wer fünf Fragen mit Ja beantwortet, ist nach Dr. Mentzels Erfahrungen zumindest suchtgefährdet; zehn und mehr Ja-Kreuzchen bedeuten mit ziemlicher Sicherheit, dass jemand arbeitssüchtig ist.
Arbeitssucht
Im deutschsprachigen Raum wurde der Begriff der Arbeitssucht von Dr. G. Mentzel, dem ersten Ärztlichen Direktor der Hardtwaldklinik II in Bad Zwesten, im Jahr 1979 erstmals verwendet. Mentzel vergleicht die Arbeitssucht mit der Alkoholsucht und erkennt viele Parallelen.
Trotz seiner weiten Verbreitung hat sich der Begriff Arbeitssucht bisher nicht in der offiziellen medizinisch-psychiatrischen und psychologischen Diagnostik durchsetzen können. Trotzdem besteht Übereinstimmung darin, dass es arbeitssüchtiges Verhalten gibt.
Von einer Sucht ist immer dann auszugehen, wenn der Betreffende ohne seinen Stoff nicht mehr auskommt, die Dosen steigert, unter Entzugserscheinungen leidet, zunehmend das Interesse an früher wichtigen Dingen in seinem Leben verliert und soziale oder gesellschaftliche Aufgaben und Verpflichtungen vernachlässigt. Die jeweilige Droge bestimmt sein Leben und schädigt den Menschen zunehmend körperlich, sozial und seelisch.
Wie das pathologische Glückspiel, so gehört die Arbeitssucht zu den stoffungebundenen Süchten.
Die Arbeitssucht ist, wie alle anderen Süchte ein Selbstheilungsversuch, ein Konfliktlösungsversuch, wobei der Konflikt dem Betreffenden meist nicht bewusst ist. Der Arbeitssüchtige versucht unangenehme Gefühle wie Depressionen, Kontaktängste, Selbstunsicherheiten, Entwurzelungsgefühle usw. oder aber angstmachende Gedanken und Situationen abzuwehren.
Arbeitssucht kann der Kompensation realer oder fantasierter Minderwertigkeiten oder aber als Ersatzbefriedigung erlebter Mängel dienen.
Arbeitssucht bemisst sich nicht daran, wie viel jemand arbeitet, sondern daran, was jemand nicht mehr tun kann. Arbeitssucht wird also nicht durch die Quantität der Arbeit definiert, sondern durch die Bedeutung und Funktion, die die Arbeit für den Betreffenden hat.
Betrachtet man sich arbeitssüchtiges Verhalten, so zeigt sich eigentlich meist eine gewisse Dranghaftigkeit in der Arbeit, eine Arbeitswut mit Selbstbestrafungstendenz und selbstzerstörerischem Charakter. Bei der Arbeitssucht geht es weniger um befriedigenden Lustgewinn wie bei stoffgebundenen Süchten, sondern eher um das Problem der Zerstörung.
Bei Arbeitssüchtigen ist sehr häufig eine zwanghaft-perfektionistische Grundeinstellung vorzufinden, wobei die Arbeit nach bestimmten Regeln ablaufen muss und Flexibilität und innovative Veränderungen des Arbeitsablaufes vermieden werden. An die Quantität oder aber Qualität der Arbeitserledigung werden hohe Ansprüche gestellt - unabhängig von der Bedeutung der Arbeitsaufgabe für das Gesamte.
Dem Betroffenen ist der süchtige Charakter seines Arbeitsverhaltens in der Regel nicht bewusst: Wie bei allen anderen Süchten besteht eine starke Verleugnungstendenz. Dieses wirkt bei der Arbeitssucht umso stärker, als die Ergebnisse süchtigen Arbeitens oft eine hohe gesellschaftliche Anerkennung finden. Auch sind körperliche und seelische Schädigungen bei Arbeitssüchtigen weniger offensichtlich. Recht deutlich zeigt sich jedoch bei Arbeitssüchtigen die Zerstörung ihrer zwischenmenschlichen Beziehungen sowohl in der Familie als auch im Beruf.
Arbeitssüchtige Patienten sind oft isoliert. In die Behandlung kommen sie in der Regel über sekundäre Symptome, also im Zustand einer depressiven Krise nach Scheidung oder Verlust der Familie oder aber mit unterschiedlichsten Spannungs- oder Schmerzsymptomen.
Der Behandlungsansatz sollte konflikt- und lösungsorientiert sein, wobei die stationäre Psychotherapie die Methode der Wahl ist, da die Betroffenen zunächst aus ihrem beruflichen Milieu herausgelöst werden müssen, um mit ihnen überhaupt Psychotherapie machen zu können.
Konfliktorientiert heißt dabei, dass dem Betroffenen verdeutlicht werden muss, dass er mit seinem arbeitssüchtigen Verhalten einen ihm nicht bewussten Konflikt zu lösen versucht, im Sinne einer Selbstmedikation.
Erst wenn dem Betroffenen Grundzüge seines Konflikt bewusst sind, ist es sinnvoll, lösungsorientiert konkrete Bewältigungsmöglichkeiten zu erarbeiten.
Auf der Ebene der Lösungsorientierung geht es um Fragen der Zeitplanung, der Arbeitsorganisation, der Wiederbelebung und Neuentdeckung von Interessen außerhalb der Arbeitswelt, der Pflege sozialer Beziehungen und der Frage nach Entspannungstechniken.
Schwierig ist bei der Therapie von Arbeitssucht, dass im Gegensatz zur Alkoholsucht nicht die vollständige Abstinenz Therapieziel sein kann, sondern ein gesundheitsdienliches Verhältnis zwischen Arbeit und Freizeit.
Wegen der Rückfallsgefahr ist immer die Notwendigkeit einer anschließenden ambulanten Psychotherapie mit dem Patienten zu besprechen.
Literaturempfehlung:
Rainer Schwochow, „Wenn Arbeit zur Sucht wird“, Fischertaschenbuch 14008
Weitere Informationen im Internet unter
www.hardtwaldklinik2.de
E-Mail
info@hardtwaldklinik2.de
Hardtwaldklinik II, Hardtstr. 32, 34596 Bad Zwesten, Telefon 05626 88-0"